Informationen zur überaktiven Blase
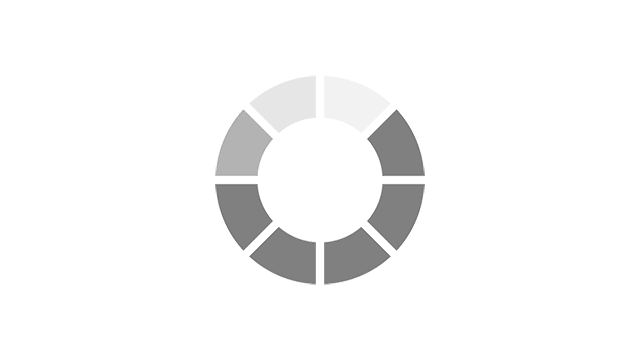
Das Ziel der Therapie ist es, die Symptome wie Harndrang, häufiges und/oder nächtliches Wasserlassen und einen unwillkürlichen Urinverlust zu lindern oder zu beheben. Die Behandlung der überaktiven Blase umfasst verschiedene Punkte. Das Trinkverhalten und Blasentraining, das Beckenbodentraining und eine mögliche medikamentöse Behandlung.

Der Gedanke «weniger Trinken = weniger Harndrang» wird Ihnen zunächst plausibel erscheinen. Er stimmt jedoch so nicht. Denn wenn Sie weniger trinken oder gar dursten, sammeln sich in der reduzierten Urinmenge reizende Harnbestandteile in höheren Konzentrationen. Das wiederum kann die Blasenüberaktivität verstärken.
Empfohlen wird meist eine Trinkmenge von täglich etwa 1–2 Liter. Trinken Sie die Flüssigkeit gleichmässig über den ganzen Tag. Nächtliche Toilettengänge können Sie möglicherweise vermeiden, indem Sie das meiste davon vor 18 Uhr trinken. Gehen Sie vor dem Schlafengehen noch einmal auf die Toilette. Mindestens die Hälfte der täglichen Trinkmenge sollte reines Wasser ohne Kohlensäure sein. Ansonsten bieten sich Saftschorlen, Früchte- und Kräutertees an. Verzichten Sie möglichst auf zucker- und süssstoffhaltige Getränke, Kaffee und Alkohol. Sie können die Blase reizen und dazu führen, dass Sie häufiger auf die Toilette gehen müssen.

Dazu gehört, dass Sie planen, nur zu festgesetzten Zeiten auf die Toilette zu gehen. Beginnen Sie mit realistischen Zeitabständen und steigern Sie diese dann langsam. Wenn der Harndrang kommt, versuchen Sie, einige Minuten zu warten bzw. den Toilettengang hinauszuzögern. Auf diese Weise wird es Ihnen gelingen, die Abstände zwischen den Toilettengängen zu verlängern. Das macht Sie im Alltag sicherer und weniger abhängig von öffentlichen Toiletten.

Wahrscheinlich geht es Ihnen wie vielen Menschen. Bislang haben Sie nicht bewusst auf Ihren Beckenboden geachtet. Dabei hat diese Körperregion viele wichtige Funktionen:
Der Beckenboden besteht aus Bindegewebe und mehreren Schichten Muskulatur. Sie verlaufen zwischen Schambein und Steissbein und bilden eine Art Schlinge um den Genitalbereich. Unter der Harnblase breitet sich der Beckenboden wie eine Hängematte aus.
Wie alle Muskeln, die der Körper willentlich aktivieren kann, können Sie auch den Beckenboden durch gezielte Übungen wieder stärken.
Das Training wirkt mit Geduld und regelmässigen Wiederholungen am besten. Um den Beckenboden nachhaltig zu trainieren, sollten Sie mindestens drei Monate konsequent üben. Dabei genügt es, wenn Sie täglich drei Minuten Zeit aufwenden. Bei den meisten Übungen geht es um gezielt ausgeführte Bewegungen – und nicht um sportliche Leistung.
Männer leiden nach einer Prostata-Operation gelegentlich unter unfreiwilligem Urinverlust und Harndrang. Um solche Beschwerden zu reduzieren, machen Sie am besten bereits vor dem Eingriff Beckenbodenübungen. Studien unterstützen dieses Vorgehen. Sprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt darüber oder wenden Sie sich an eine spezialisierte Physiotherapeutin / einen spezialisierten Physiotherapeuten.
Methoden wie Elektrotherapie und Biofeedback können das Beckenbodentraining sinnvoll ergänzen.

Zur Behandlung der überaktiven Blase stehen verschiedene Arzneimittel zur Verfügung. Bei leichteren Beschwerden können homöopathische oder pflanzliche Arzneimittel eine Möglichkeit bieten. Die Ärztinnen und Ärzte behandeln die überaktive Blase mit traditionellen Arzneimitteln, die am Blasenmuskel wirken und das Fassungsvermögen der Blase erhöhen, indem der Blasenmuskel entspannt und der komplexe Prozess der Blasenentleerung beeinflusst wird. Hier stehen verschiedene Arzneimittel mit unterschiedlichen Wirkstoffen zur Verfügung. Diese können von Ärztinnen und Ärzten individuell nach Patientenbedürfnissen eingesetzt werden.
Eine weitere Methode ist die Botox-Injektion (Botulinumtoxin-A-Injektionen), welche direkt in die Harnblasenwand erfolgt. Die Überaktivität des Muskels in der Harnblase (Detrusormuskel) wird gedämpft. Das kann die (zu) häufigen Toilettengänge und oft auch den unwillkürlichen Urinverslust verringern.
Bei der tibialen Nervenstimulation wir der Nervus tibialis durch äusserlich angebrachte Elektroden stimuliert, wodurch eine Beruhigung der Blase angestrebt wird. Des Weiteren können sogenannte «Blasenschrittmacher» (sakrale Neuromodulation) eingesetzt werden, wodurch mittels implantierter Elektroden bestimmte Nervenbahnen stimuliert werden.
Eine operative Behandlung wird in Erwägung gezogen, sofern mit genannten Therapien kein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht werden kann oder sofern dies medizinisch unumgänglich ist.
Wenn Sie das Gefühl haben von einer überaktiven Blase betroffen zu sein, sprechen Sie offen mit einer Fachperson über Ihre Beschwerden und lassen Sie sich beraten.